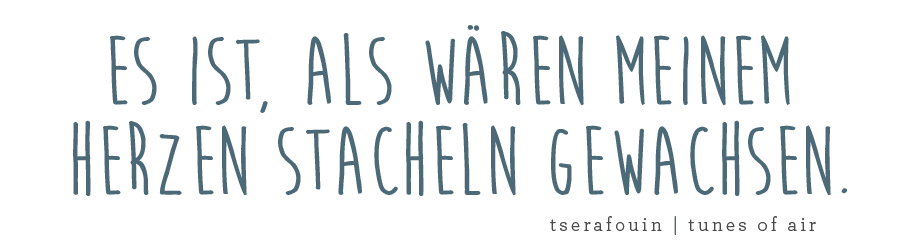Ich erwache um sechs Uhr relativ ausgeschlafen, für meine Verhältnisse, aber schliesslich bin ich gestern ja auch schon um sieben Uhr ins Bett, weil ich dermassen hinüber war. Zwar bin ich um elf nochmals aufgewacht, war aber gescheit genug, mich einfach umzudrehen und weiterzuschlafen. Die Nacht war unruhig, ich erwachte dauernd und träumte Scheiss, noch mehr als sonst, und einige Male dachte ich, ich würde wohl nicht mehr einschlafen können, bewies mir aber doch immer das Gegenteil.
Ich habe also letzte Nacht rund zehneinhalb Stunden geschlafen. Nicht ganz doppelt so viel wie sonst. Und doch hätte ich noch vor dem Mittagessen schon wieder schlafen können. Vielleicht ist es das Wetter, vielleicht ist es die Jahreszeit, vielleicht die Tatsache, dass ich am Mittwoch Fieber hatte und es mit NeoCitran in die Flucht jagte, zusammen mit der Erkältung, die es mit sich schleppte.
Aber eigentlich bin ich im Winter ja immer müde. Nicht nur körperlich. Vielleicht wird dieser Winter besser.
Im Geschäft werden Dinge erledigt, Rechnungen ausgedruckt, ein paar Dinge für nach den Ferien vorbereitet. Nach der Arbeit kaufe ich neue wintertaugliche Reitschuhe, das schiebe ich seit drei Wintern vor mich her, weil ich immer erwartet hatte, vielleicht im nächsten Winter nicht mehr zu reiten, ohne das Monsterpferd, als ob, als ob. Und jetzt wird es nass und irgendwann wieder kalt und die alten Schuhe haben einige Winter gehalten und sind jetzt endgültig kaputt.
Ich bilde mir ein, dass das Torkeltier sich langsam freut, wenn ich komme, und sich an mich gewöhnt, und irgendwie ist das schon schön, obwohl ich mir ja vorgenommen habe, mich nicht mehr zu sehr an ein Tier zu hängen. Sie machen es aber einem ja auch nicht einfach, das nicht zu tun, dankbar und freundlich wie sie sind, zum Teufel nochmal. Im Dunkeln füttere ich dem Torkler eine Banane, ich glaube, er mag Bananen, er hat sie jedenfalls mit Begeisterung gefressen. Morgen gibts den Härtetest: braune, matschige Bananen.
Auf dem Weg nach Hause bemerke ich, wie Strasse und Trottoir stellenweise schon wieder glitzern, wie sie das in den vergangenen zwei Wochen immer getan haben, wenn ich unterwegs war, dabei hatte ich eigentlich das Gefühl, dass es heute nicht ganz so kalt ist. Wahrscheinlich sitzt die Kälte im Boden fest.
Je näher ich dem Dorf komme, umso mehr Nebel kriecht mir entgegen. Oben auf dem Hügel, bevor es zum Weiler hinunter geht, in dem ich wohne, muss ich stehen bleiben und den Anblick bewundern, der sich mir da bietet. Auf der Kuppe steht ein Bauernhaus, dessen Fenster in einem warmen Gelb leuchten, daneben zeichnet sich das Dach des Stalls dunkel gegen den Himmel ab.
Ich staune den Mond an, zwei Tage nach Vollmond leuchtet er immer noch unglaublich hell, zeichnet von den Baumskeletten lange Schatten auf die Wiese. Nebel kriecht vom Wald her in Richtung Strasse und hängt ein wenig in der Senke fest, er leuchtet richtig im Mondschein. Ich wünschte, ich könnte das irgendwie fotografieren oder noch besser zeichnen, malen, aber in derlei Dingen bin ich ja gänzlich unbegabt.
Die ganze Szene verändert sich langsam. Der Nebel kommt näher, frisst die Baumschatten auf, die Wolken über dem Nebel werden dichter und gerade, bevor der Moment seine Magie verliert, höre ich ein Auto näher kommen und gehe weiter. Als ich auf den Hof komme, galoppiert mir der Kater entgegen, miaut mich an, dreht sich um, rennt davon und erwartet mich dann ungeduldig vor der Haustür.